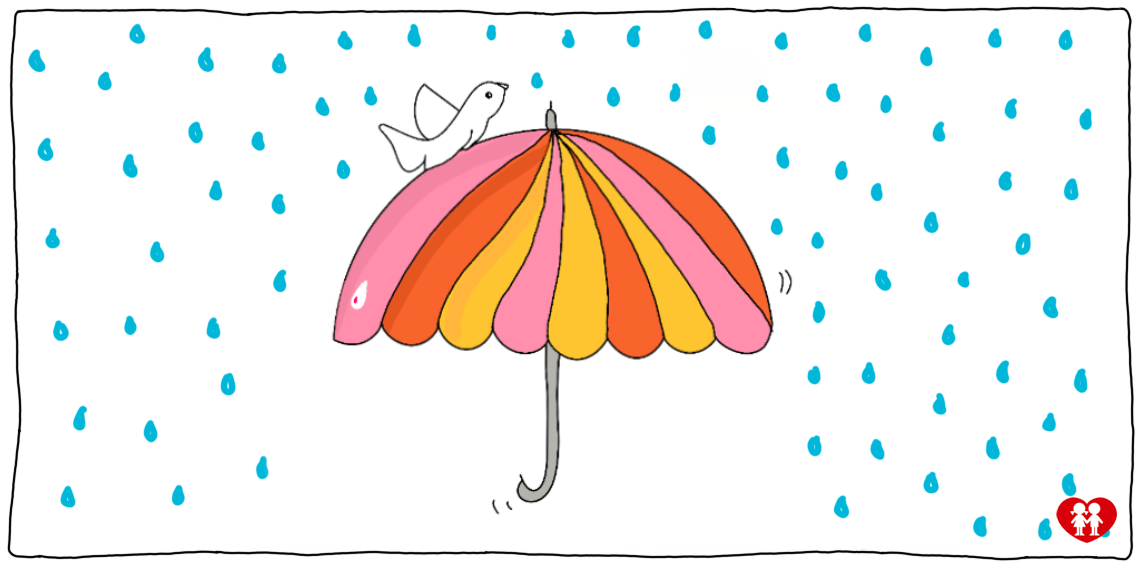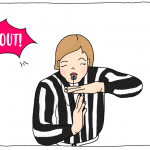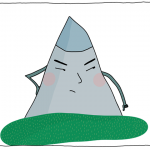Es gibt Dinge
auf der Welt, die sich eigentlich
nicht in Worte fassen lassen. Weil sie derart unerträglich sind, dass es sie eigentlich gar nicht geben dürfte. Und
weil eigentlich jeder und jede
einzelne, der darüber Bescheid weiß, sofort alles Menschenmögliche dafür tun müsste,
dass diese Zustände sofort beendet werden. Zum Beispiel wenn ein Schiff mit
hunderten verängstigten, dehydrierten und unterkühlten Kindern über das
Mittelmeer schippert und von einem Hafen zum nächsten geschickt wird, weil es
niemand anlegen lassen will, dann ist das unerträglich. Wenn Frauen und Männer
in libyschen Flüchtlingslagern wie Sklaven verkauft, gefoltert und vergewaltigt
werden, dann ist das ein Zustand, den wir als Menschen nicht akzeptieren
dürfen. Oder wenn tausende und abertausende vor der Küste Europas jämmerlich
ersaufen, dann dürften wir nicht schulterzuckend zusehen, sondern müssen alles
tun, um diese Zustände zu beenden. Jeder Tag, an dem diese Dinge passieren und
wir sie nicht verhindern, müsste uns vor Wut aus der Haut fahren lassen.
Eigentlich müsste es das. Eigentlich.
Dieses
„eigentlich“, das irgendwie bedeutungslos und doch so aussagekräftig durch den
obigen Text wabert, ist hierbei das Schlüsselwort. Es ermöglicht uns, bei
genauerem Hinsehen in die hässliche Fratze des Zeitgeistes und unseres eigenen
Daseins zu blicken. Denn während frühere Generationen noch heute davon
sprechen, dass sie von allen Gräueltaten nichts gewusst hätten, so gilt diese
Ausrede heute nicht mehr. Natürlich wissen wir, was im Mittelmeer oder in
Libyen geschieht, wir sehen jeden Tag die Bilder im Fernsehen, wir lesen die
Statistiken in der Zeitung, wir hören Berichte von Augenzeug/innen. Und eigentlich wüssten wir alle, was das
Richtige wäre, nämlich diesen Menschen zu helfen. Doch wir tun es einfach nicht.
Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, deren Leistung in der Seenotrettung oder
durch ihre Arbeit in NGOs nicht hoch genug zu würdigen ist, so sitzen wir in
unserer Festung Europa und verschließen Augen und Ohren vor der täglichen
Katastrophe, die sich vor unserer Haustür abspielt. Doch es gibt noch andere:
Jene, die auf ihren Pegida-Demos brüllen, man möge sie doch einfach absaufen
lassen. Die applaudieren, wenn Seenotretter eingesperrt werden oder gar eigene
Schiffe chartern und sich dabei bis auf die Knochen blamieren. Sie werden
angefeuert von einer Politik, die sich auf das Schließen von Routen, aber
vorrangig auf das Zündeln und Schüren von Ängsten und Hass spezialisiert hat.
Doch weder die schweigenden, die brüllenden, noch die zündelnden können einander
gegenseitig als Ausrede verwenden: Jeder und jede einzelne muss sich jeden
Abend in den Spiegel schauen können. Jeder und jede einzelnen muss in einem
stillen Moment mit seinem eigenen Gewissen zu Rande kommen. Und irgendwann
werden wir alle uns von unseren Kindern fragen lassen müssen, wo wir im Jahr
2018 waren. Was wir getan haben, als Kinder in der Hoffnung auf ein besseres
Leben vor unseren Augen vom Mittelmeer verschluckt wurden. Warum wir zugelassen
haben, dass Hilfesuchende zurück in Krieg, Zerstörung und den sicheren Tod
geschickt wurden. Wie es passieren konnte, dass sich Fremdenhass und
Ausgrenzung mit unserer Geschichte schon wieder in der Gesellschaft etabliert
haben. Der Gedanke daran, auf diese Fragen keine Antwort zu haben, erschüttert
mich bis ins Mark. Das ist aber noch lange nicht genug. Wir müssen die Zündler
entlarven, den Brüllern gegenübertreten und die große Zahl der Schweiger
aufrütteln. Wir, das sind zum Beispiel Organisationen wie die Kinderfreunde.
Weil es seit über 100 Jahren unsere Aufgabe ist, die Welt zu verändern. Weil es
die Welt braucht, aber auch, weil wir es selbst brauchen. Nicht nur eigentlich,
sondern wirklich.